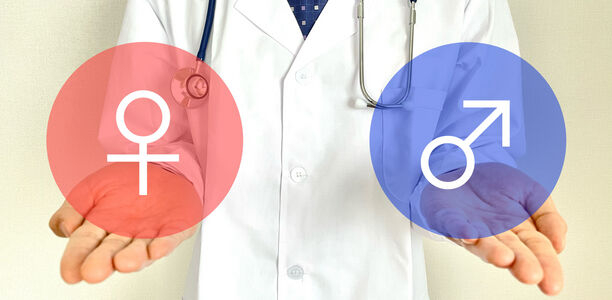Frauen und Männer haben oftmals einen unterschiedlichen Diabetes-Verlauf – doch darauf wird in der praxis noch immer unzureichend reagiert. Die DDG fordert daher mehr Geschlechtersensibilität in Forschung, Prävention und Versorgung.
Frauen mit Diabetes tragen nach den Wechseljahren ein um 40 Prozent höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden als gleichaltrige Männer. Auch die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall steigt für sie um 25 Prozent. Solche geschlechtsspezifischen Unterschiede müssten stärker in Prävention und Diagnostik einbezogen werden, betonte die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) anlässlich ihres Diabetes Kongresses 2025.
Unterschiede in Biologie und Verhalten
Neben biologischen Faktoren unterscheiden sich auch der Umgang mit der eigenen Gesundheit, die Wahrnehmung von Symptomen und die Reaktion auf Medikamente bei Männern und Frauen deutlich – mit direkten Folgen für den Krankheitsverlauf. Wie eine geschlechtersensible Diabetologie künftig aussehen könnte, stellte Professor Dr. Julia Szendrödi, Präsidentin der DDG, auf der Kongress-Pressekonferenz am 30. Mai vor.
„Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Biologie, sondern auch in Lebensrealität, Gesundheitsverhalten und Zugang zur Versorgung. Diese Unterschiede müssen wir ernst nehmen“, erklärte Szendrödi, die zugleich Ärztliche Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechselkrankheiten und Klinische Chemie am Universitätsklinikum Heidelberg ist. Nur wenn das Geschlecht als medizinischer Einflussfaktor anerkannt werde, sei eine bedarfsgerechte Behandlung möglich.
Soziale Faktoren erschweren die Versorgung
Besonders Frauen sind häufig mehrfach belastet: Sie tragen oft die Hauptverantwortung für Kinderbetreuung und Pflege und müssen gleichzeitig berufliche Anforderungen meistern. Hinzu kommen finanzielle Nachteile, eingeschränkter Zugang zu Bildung und strukturelle Hürden im Gesundheitssystem. Diese sozialen Faktoren erschweren nicht selten eine rechtzeitige Diagnose oder eine wirksame Behandlung. Laut Szendrödi würden sich viele Frauen „häufig selbst zuletzt wahrnehmen“ – daran müsse sich etwas ändern.
Ein weiteres Problem ist die geringe Beteiligung von Frauen an klinischen Studien. Prämenopausale Frauen werden oft nicht einbezogen, obwohl der Menstruationszyklus die Insulinempfindlichkeit nachweislich beeinflusst. Zwei Drittel aller betroffenen Frauen verzeichnen in der zweiten Zyklushälfte eine verringerte Wirksamkeit der Insulintherapie. Während der Menopause verschärfen zudem vermehrtes Bauchfett und zunehmende Insulinresistenz die Stoffwechsellage.
Männer oft weniger therapietreu
Doch auch bei Männern gibt es Handlungsbedarf. Sie neigen häufiger dazu, verordnete Therapien nicht konsequent umzusetzen, insbesondere bei Begleiterkrankungen wie Krebs. Dennoch werde ihr Therapieansprechen in Studien oft als allgemeiner Standard betrachtet, kritisierte Szendrödi. Die unterschiedlichen Wirkungen von Medikamenten bei Männern und Frauen fänden bislang nur selten Eingang in Forschung und Leitlinien. Das Ergebnis sei eine Medizin, „die beiden Geschlechtern nicht gerecht wird“.
DDG fordert verbindliche Maßnahmen
Die DDG spricht sich dafür aus, geschlechtsspezifische Unterschiede konsequent in allen Bereichen der Diabetologie zu berücksichtigen. Dazu gehören gendersensible Studien zu antidiabetischen Medikamenten in verschiedenen Lebensphasen, die Einbeziehung patientenberichteter Ergebnisse und die verpflichtende Erfassung geschlechtsspezifischer Daten – etwa zur Parität der Geschlechter, zum Beginn der Menopause oder zum hormonellen Status.
Zudem fordert die Fachgesellschaft ausreichend große Studien, um Unterschiede statistisch sauber abbilden zu können, sowie die Entwicklung praxisnaher Schulungsprogramme und Handlungsempfehlungen. „Wir brauchen eine datengestützte, differenzierte und gerechte Medizin, die geschlechtsspezifische Unterschiede systematisch erfasst, auswertet und in klinische Entscheidungen einfließen lässt“, betonte Szendrödi. Dazu gehörten verbindliche Standards in Forschung und Versorgung, die Berücksichtigung hormoneller Lebensphasen und gezielte Fortbildungen für alle Gesundheitsberufe.
von Redaktion diabetologie-online
mit Materialien der Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)