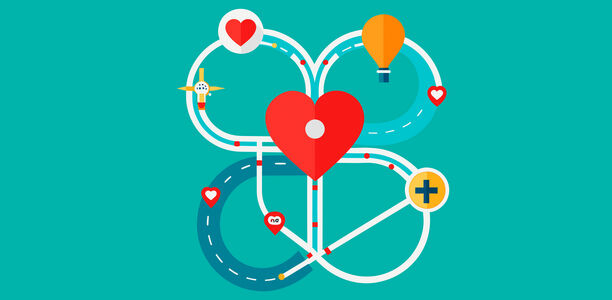Die Diabetologie in den Kliniken ist derzeit damit beschäftigt, wegweisende Strukturen zu etablieren, um die Behandlung der Patienten sicherzustellen. Politische Entscheidungen haben dabei einen entscheidenden Einfluss. Was getan werden kann, beschreiben Simone von Sengbusch und Torben Biester.
Die Prävalenz von Diabetes mellitus nimmt zu, dieses gilt sowohl für Typ1 wie auch für Typ2 Diabetes im Kindesalter und bei Erwachsenen. Beim Typ-2-Diabetes könnte durch eine nationale Diabetesstrategie durch Verhaltens- und Verhältnisprävention die Neuerkrankungsrate effektiv beeinflusst werden, während bei der Autoimmunerkrankung Typ-1-Diabetes die modulierenden Immuntherapien in Frühstadien der Erkrankung nur begrenzt einsetzbar sind.
Hintergrund
Gegenüber dieser steigenden Anzahl von Diabetes betroffenen Menschen steht zwar eine steigende Anzahl von jungen Ärzt:innen, die berufstätig werden, aber gleichzeitig nimmt auch die Teilzeitbeschäftigung zu, so dass die absolute Anzahl von Ärzt:innen in einem Fachgebiet keine Aussage über die tatsächliche Versorgungsleistung zulässt. Eine diabetologische Weiterbildung kann erst nach mit der Facharztreife begonnen werden. Weiterbildungsbefugte Diabetolog:innen finden sich zunehmend mehr in Praxen als in den Kliniken, wo die Facharztausbildung stattfindet. Eine längerfristige Tätigkeit an einer Klinik geht auch nach dem Facharzt mit Dienstverpflichtungen einher. In der Folge verlassen qualifizierte Fachärzt:innen Kliniken auf der Suche nach attraktiven Stellen, in der sie ihre Weiterbildung auch umsetzen können. Hinzu kommt, dass ca. 23 % der berufstätigen Ärzt:innen über 60 Jahre alt sind und in 5-10 Jahren ihre Berufstätigkeit beenden werden. Zur Altersstruktur der Beschäftigen in Diabetesberatungsberufen liegen keine Daten vor.[1]
Eine Aufgabe der Diabetologie und der Gesundheitspolitik wird es sein, diesem Wandel Versorgungsmodelle entgegenzusetzen, die eine diabetologisch qualifizierte Versorgung in Klinik und Praxis, in Ballungsräumen und im ländlichen Bereich, gewährleistet.
Einfluss der Zentrumsgröße auf die Versorgungsqualität
Eine Möglichkeit zur Darstellung, um eine Vergleichbarkeit zwischen Kliniken zu schaffen, soll der neue Klinikmonitor der Bundesregierung sein, der hier allerdings bisher wenige Informationen bietet.2 Derzeit zeigt die Suche nach "Pädiatrie/Schwerpunkt Endokrinologie (Hormon-/Stoffwechselstörungen, Diabetes)" bundesweit eine Klinik. Dies entspricht nicht der Realität.
Das DPV-Register der deutschsprachigen Kinderdiabetologie hat hier in einer Arbeit untersucht, wie sich ein möglicher Zusammenhang von Zentrumsgröße zu Therapieergebnis zeigt.(1)
Hierbei schnitten die eher kleineren Behandlungszentren nicht so gut ab: in diesen lag der HbA1c am höchsten. Der geringste mittlere HbA1c-Wert lag hier in den mittelgroßen Behandlungszentren vor. Insgesamt gab es aber einen Trend zu mehr größeren Behandlungseinrichtungen: die Zahl der Zentren mit weniger <50 Patient:innen ist von 81 auf 72 gesunken, während die Zahl der größeren Zentren und die absolute Anzahl der dort behandelten Kinder zunahm. Höhere mittlere HbA1c-Werte bei den größten Zentren spiegeln einen Effekt wider, der auch von anderen Krankheitsbildern bekannt ist: die Patient:innen mit komplexen Therapieverläufen konzentrieren sich in den größten Zentren.
Für andere Krankheitsbilder gibt es daher bereits auf Grundlage von § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Mindestmengen in der Behandlung, z.B. Frühgeborene <1250g Geburtsgewicht oder bestimmte planbare Operationen.(2) Damit soll eine gesicherte Therapiequalität durch einen höheren Erfahrungsgrad gesichert werden.
Erfolgreiche Telemedizin
Eine Möglichkeit der Überbrückung von Distanzen zur Durchführung einer medizinischen Maßnahme (Therapie/Schulung/Beratung) sind telemedizinische Anwendungen.
In den USA wurde eine große Studie durchgeführt, bei der Kinder und Jugendliche kurz nach Manifestation mit einem AID-System versorgt wurden. Die Zuordnung der Gruppen erfolgte per Zufallsprinzip. Es zeigte sich, dass die Zeit im Zielbereich in der Gruppe mit AID höher lag als in der Vergleichsgruppe mit Sensor aber ohne AID. Das besondere war, dass alle AID-Schulungen per Video erfolgt sind. Der Grund war, dass die Studie während der Hochphase der Covid19-Pandemie stattgefunden hat. Auch wenn diese Form der Schulung hier nicht Gegenstand der Untersuchung war, muss es doch als erfolgreich angesehen werden.(3)
In Deutschland konnte von der Universität Lübeck gezeigt werden, dass Kinder, die eine Sensor-unterstützte Pumpen- oder Pentherapie durchführen, von einer telemedizinischen Zusatzbetreuung profitieren und sowohl Familien wie auch Behandler sehr zufrieden mit der Telemedizin waren.(4-6)
Ein auf Videosprechstunde basierendes Versorgungsmodell stand bisher nur Kinder und Jugendlichen bestimmter gesetzlicher Krankenkassen im Rahmen eines §140a SGB V Vertrags zur Verfügung. Im Jahr 2024 wird nun aber eine Ausweitung dieses erprobten Versorgungsmodells durch Streichung des Bundeslandbezug erreicht werden können und damit zumindest für einen Teil der Kinder eine Option darstellen. Bei bundesweit geltenden Selektiverträgen mit bestimmten Krankenkassen ist aber ein Beitritt der Versorger (Kliniken/Praxen) zu einem Vertrag die Voraussetzung.
Modell aus den USA
Im ECHO-Modell bedient das "Experten-Zentrum" nicht direkt die entfernt lebenden Patient:innen, sondern die kleineren Zentren, die dann wiederum die direkte Versorgung betreiben. Ursprünglich für geriatrische Patienten in New Mexico entwickelt, wurde das Modell inzwischen von vielen Zentren bei verschiedenen Krankheitsbildern angewandt.
Die Evaluation des Echo-Modells beim Diabetes wurde auf mehreren Ebenen evaluiert.
- Struktur, Prozess, Outcome
- Höhere Anzahl an HbA1c-Messungen
- Höhere Wiedersehensquote von Menschen mit HbA1c >9
- Mehr CGM-Verschreibung
- Vorhandensein von Sick-Day-Plänen
- Steigerung Zufriedenheit bei Teams und Patient:innen
- Identifikation und Lösungsansätze für unterrepräsentierte Gruppen
In allen Teilbereichen hat sich die Anwendung des Modells als erfolgreich gezeigt, es gab eine hohe Zufriedenheit der Satellitenzentren. Leider musste das Projekt Ende 2023 mit Ende der Fördergelder eingestellt werden.(7, 8)
Übertragung nach Deutschland?
Seit 2002 müssen gesetzliche Krankenkassen ihren Versicherten sogenannte Disease Management Programme (DMP) nach §137f SGB V(9) anbieten. Das Bundesamt für soziale Sicherung kann diese Programme auf Antrag der Krankenkassen für bestimmte Krankheitsbilder zulassen. Hierbei handelt es sich um ein Modell der Fallsteuerung. Dieses dient einem Fallmanagement, dessen Struktur sich an den aktuellen Leitlinien zu dem entsprechenden Krankheitsbild orientiert, die Inhalte werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt. Chronisch kranken Menschen soll dadurch eine kontinuierliche Betreuung auf dem Level der aktuellen evidenzbasierten Medizin geboten werden.
Es handelt sich somit um ein Modell der Sekundärprävention, das heißt, die Folgen einer bereits eingetretenen Erkrankung zu mildern oder zu verhindern.
Weiterhin sollen die Programme die Strukturqualität in der Versorgung sicherstellen und diese somit verbessern. Hierfür sind in einer standardisierten Dokumentation Kennzahlen zu erfassen, die zentral für das entsprechende Programm ausgewertet werden. Teilnehmende Praxen bekommen entsprechende Feedback-Berichte. Die Vergütung ist an das Erbringen der Dokumentation gekoppelt.
Diese gegenwärtige DMP-Struktur steht der Telemedizin im Weg.
Es werden in regelmäßigen Abständen die Dokumentation HbA1c-Messungen verlangt, die als kapillärer Messwert nur in Diabetologischen Zentren und Diabetesschwerpunktpraxen zur Verfügung stehen, die über entsprechende Messgeräte verfügen. Um, vor allem bei Kindern, auf eine venöse Blutentnahme zu verzichten, muss daher ein Zentrum oder eine Schwerpunktpraxis aufgesucht werden. Mit der CGM-Versorgung für Menschen mit Typ1-Diabetes stehen aber mit den Daten aus dem Glukosesensor (Glukose-Management-Indikator GMI, Time-in-Range, Time-below-Range, Time-above-Range) jederzeit in einer Cloud zur Verfügung. Die Präzision der CGM-Paramater ist in den meisten Fällen für die Stoffwechselbeurteilung ausreichend. In Ausnahmefällen, z.B. bei einer Eisenmangelanämie, kann es relevante Differenzen zwischen HbA1c und CGM-Parametern geben, zumeist sind aber Sensordaten für eine telemedizinische Betreuung ausreichend. Für eine Betreuung im DMP-Vertrag reichen aber CGM-Parameter nicht. Ebenso kann das DMP in seinen Schulungsstrukturen der sich rasch ändernden Technologie keine Rechnung tragen. In der Vergangenheit war bei manchen Krankenkassen eine DMP-Teilnahme gar verpflichtend als Voraussetzung für die Versorgung mit CGM-Geräten.
Eine Teilnahme an einem Videosprechstundenversorgungsmodell, wie in Schleswig-Holstein seit Jahren praktiziert, schließt eine DMP-Teilnahme aus, da die Bedingungen der quartalsweisen Kontakte mit Messungen und Laborbefunden nicht mehr erfüllt werden können. In diesem Modell kommen die Kinder und Jugendliche nur einmal pro Jahr in die Spezialambulanz, erhalten aber stattdessen 5-10 Videokontakte pro Jahr, sie sind also höherfrequent versorgt, als in der Regelversorgung.
Wenn eine Praxis oder Klinik sich einem Selektivvertrag anschließen möchte, um Videosprechstunde als Versorgungsmodell bestimmter Versicherung umzusetzen, müssen viele Aufgaben erfüllt werden:
Neben dem Aufwand der Beantragung der Teilnahme als Praxis an so einem Selektivvertrag müssen auch die Arbeitsstrukturen und Abläufe in jeder Einrichtung neu organisiert werden; auch die Behandelten müssen sich umgewöhnen.
Einmal etabliert, kann eine Videosprechstunde im o.g. Rahmen dazu beitragen, Distanzen zu überwinden und unnötige "Vor-Ort"-Termin bei problemloser Therapiedurchführung zu reduzieren.
Die Videosprechstunde und andere telemedizinische Betreuungs- und Schulungskonzepte sind effektiv und effizient, von Patienten gewünscht und heute auch technisch datenschutzkonform umsetzbar. Telemedizin ermöglicht auch Arbeiten im Home-Office bzw. mobiles Arbeiten und führt zu einer Steigerung der Attraktivität von Arbeitsplätzen und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Wünschenswert wäre die Ergänzung bestehender Selektivverträge, um die Möglichkeit der Beratung auch durch Schulungsfachberufe und der Einführung eines Risiko-adaptieren Einbestellmanagements. Hierfür sind Computerprogramme denkbar, die auf Basis der digitalen Therapiedaten aus Sensor und Pumpe die Notwendigkeit der Vorstellung "triagieren". Ein exzellent "eingestelltes" Kind oder Erwachsener benötigt auch weniger Videotermine, ein Kind oder Erwachsener mit Stoffwechselschwankungen dafür mehr. Medizinische Apps erlauben Kontakt per SMS zur Ermutigung oder für kurze Nachrichten an die Familie. Eine automatisierte, monatliche Datenauswertung erspart den enormen Zeitaufwand, der dafür bei 500-1000 Patient:innen in einer Ambulanz theoretisch nötig wäre. Praktisch ist die manuelle Auswertung aller verfügbaren Daten (AID-Pumpen, CGM-Daten in einer Cloud) kaum umsetzbar. Ein automatisiertes Auswertungs- und Triagierungs-System mit Kommunikationstool ist in den Niederlanden in den Diabeter-Kliniken bereits in Benutzung.(10)
Fazit
Die Etablierung neuer Versorgungsformen ist langwierig und schwierig. In Deutschland bietet der Innovationsfond des G-BA hier regelmäßige Ausschreibungen zur Projektförderung an.
Das telemedizinische Versorgungsmodell aus Schleswig-Holstein ist daraus hervorgegangen, hat aber den Weg in die Regelversorgung nicht direkt, sondern nur über einen Selektivvertrag gefunden. Erfreulicherweise wird dieser Vertrag jetzt aber bald deutschlandweit zumindest für bestimmte Krankenkassen als Angebot zur Verfügung stehen. Deutschlandweite Selektivverträge für alle großen Krankenkassen, eine neue EBM-Ziffer oder Telemedizin-Pauschalen für Hochschulambulanzen, die die besondere Art der Videosprechstunde als Ersatz für Diabetessprechstunden abbilden, gibt es aber noch nicht.
Insgesamt sind absehbare Probleme der Diabetesversorgung infolge zu weniger Lehrstühle für Diabetologie und Endokrinologie an den Universitätskliniken, zu wenige Weiterbildungsstellen und attraktive Arbeitsstellen für Diabetolog:innen in den Kliniken, kritische Entscheidungen zu Lasten der Abrechnung von Schulung und Behandlung in den Diabetesschwerpunktpraxen und altersbedingtem Ausscheiden von Diabetologen in den nächsten Jahren noch nicht ausreichend adressiert. Neue Versorgungsmodelle könnten zumindest helfen, die steigende Anzahl von Patient:innen mit Telemedizin bedarfsgerecht zu versorgen. Dafür müssen aber neue Versorgungsmodelle entwickelt und adäquat finanziert werden.
Text: Torben Biester, Simone von Sengbusch
[1] https://www.bundesaerztekammer.de/baek/ueber-uns/aerztestatistik/2023
[2] https://bundes-klinik-atlas.de/
|
|
|
|
Erschienen in: Diabetes-Forum, 2024; 36 (12) Seite 40-43